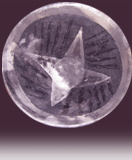
![]()

Verziertes Gefäß
![]()

Einreiben der
Inkrustationsmasse
![]()

Im oberen Bereich ist der Auftrag
der Inkrustation abgeschlossen,
unten wird der nächste
Abschnitt inkrustiert
| Verzierung nach dem Brand | ||||||||||
|
Aus der Urnenfelderzeit sind Stroheinlagen in umlaufenden Rillen bei Gefäßen nachgewiesen. Wir verwendeten dafür Strohhalme, die Erika direkt vom Kornfeld mitgebracht hatte. Die Halme wurden geschält und der Länge nach gespalten. Die Strohbänder wurden in Rillen eingelegt, die als Führung dienten. Zum Fixieren der Strohbänder mußte bereits vor dem Brand ein Löchlein an einer Stelle der Führungsrille gebohrt werden, in dem später die Enden des Strohbandes mittels kleiner Holzpflöckchen fixiert werden konnten. Die geläufigste der Verzierungsarten, die wohl oft nach dem Brand aufgebracht wurden, ist die Inkrustation vertiefter Ornamente mit einer weißen Paste. Zur Zusammensetzung dieser Füllung gibt es nur wenige Nachweise bei bronze- und hallstattzeitlicher Keramik, aber es sind Beispiele bekannt, bei denen z.B. Knochenasche und etwas Ton verarbeitet waren. Erika Berdelis Rezept für die Inkrustation besteht aus Sumpfkalk, Knochenasche und etwas Quark, d.h. es handelt sich hierbei um eine auf Kaseinbasis hergestellte Masse. Mit den Fingern trugen wir sie auf die geritzten Verzierungen auf und wuschen die Überstände sofort mit einem sauberen Schwamm ab. Um einen weißen Schleier in noch offenen Poren neben den Inkrustationen zu vermeiden, ist es wichtig, dass die Oberflächen gut geglättet und poliert sind. Kaltbemalungen sind zwar nicht mehr direkt nachzuweisen, aber dennoch indirekt auf einigen prähistorischen Gefäßoberflächen ablesbar. Wir stellten versuchsweise eine Kaseinfarbe her und trugen damit Ornamente auf einige Oberflächen auf. Auch die Anwendung weiterer Verzierungsmethoden etwa mit Birkenpech, mit Zinnfolie oder die Schwärzung heller Flächen mit Russ ist bekannt. Wir haben uns aber in unserem Seminar auf die o.g. Methoden bei der Verzierung unserer Stücke beschränkt. |
||||||||||
|
||||||||||
| |
||||||||||
| herstellungstechnik, bronzezeitlich, hallstattzeitlich, keramik, seminar, herbertingen-hundersingen, heuneburg, restauratoren, magerung, wulsttechnik, daumentechnik, verzierung,ritzverzierung, kreisaugen, stempel, farbige engobe, grubenbrand, landesdenkmalamt, baden-württemberg, württembergisches landesmuseum, stuttgart, erika, berdelis, archäologie, experiment |

